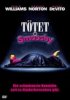FILMTIPPS.at - Die Fundgrube für außergewöhnliche Filme
www.filmtipps.at
Down in the Valley
DRAMA: USA, 2005
Regie: David Jacobson
Darsteller: Edward Norton, Evan Rachel Wood, David Morse, Bruce Dern
In Tobes Leben tritt der offenherzige, weltfremde Cowboy Harlem. Die Teenagerin verliebt sich in das stets gutgelaunte einfache Landei und auch Harlem glaubt in der Kleinen das ideale, unschuldige Mädchen gefunden zu haben, mit der er in den Horizont reiten würde. Doch Vater Wade misstraut dem Außenseiter...
KRITIK:Down in the Valley beginnt mit einer prägnanten wie bedeutungsvollen Sequenz. Ein Cowboy sieht auf ein modernes Verkehrsnetz. Ein Highway führt durch ein Gebiet, wo ehemals Rinder weideten und seine gestiefelten Ahnen Lassos wirbelten. Der Cowboy? Er geht zu Fuß. Immer tiefer in diese strommastengespickte Welt einer amerikanischen Kleinstadt, die irgendwie traurig aussieht. "Was ist passiert?" scheint sich der Cowboy zu fragen.
Es ist der typisch amerikanische Filmstoff, den der Europäer bereits aufgegeben hat zu hinterfragen. In Down in the Valley geht um die amerikanische Identität... und nur allzu leidenschaftlich drückt der Regisseur David Jacobson den Daumen in die amerikanische Identitätskrisen bzw. - Wunden, von denen er erzählen will. Und braucht dafür gerade mal vier Figuren und Konflikte, die auf den ersten Blick banal erscheinen.
David Jacobson serviert einen Cowboy, der uns zwar gefällt, weil er charmant ist, authentisch spricht, authentisch geht, (Edward Norton weiß wieder mal zu brillieren) aber dennoch werden wir das Gefühl nicht los, dass etwas an dieser vertrauten Gestalt beschädigt ist. Dass wir dieser Figur, die in ihrer Heimat ein Außenseiter geworden ist, nicht trauen sollten. Es ist Intuition, die der Film in einem anspricht und wie so viele Abhandlungen des Cowboy-Mythos ist es keine intellektuelle, sondern eine emotionale, gefühlsbetonte und sinnliche, die einige Kritiker wie so oft als naiv und flach beurteilen könnten.
An Edward Nortons Seite spielt Rachel Evan Wood, die mir von Indie-Film zu Indie-Film immer mehr gefällt und sich auch hier ohne viel Schnörkel als typisches Exemplar eines amerikanischen Coming-of-Age-Mädchens gibt.
Boy meets Girl. Der Film lässt sich Zeit und verabreicht dem Zuschauer erst mal eine sich gut anfühlende Sex, Drugs and Guitarsound-Liebesfabel, die aber unter den gegebenen Vorrausetzungen - Mädchen ist nicht volljährig, der kleine Bruder ohne Selbstbewusstsein und Idol, der Vater ein gefühlsarmseliger Tyrann (großartig: David Morse), der neue Freund ein weltfremder aber trügerisch offenherziger Typ - kein Happy End finden wird.
Ein Highlight wird dann wirklich das grotesk geartete Finale und tragikkomisch trägt der Film seine Bedeutungsschwangerschaft aus. Ich bin ein Liebhaber davon, wenn sich Regisseure verspielt zeigen und Motive von zitierten Genres zu einer kunstvollen Parabel montieren. Ein leeres Haus. Ein wieherndes Pferd. Ein trauerndes Kind. So geht's zu Ende und wir verstehen intuitiv was gemeint ist, ohne, dass wir Worte dafür finden müssen.




Kleines Indie-Juwel, halb Liebesfilm, halb moderner Western, über eine vertraute Figur, die zerstört, aber immer wieder zum Leben erweckt wird und in Konflikt mit dem neuen alten Antihelden Amerikas tritt. Dem besorgten, besitzergreifenden Vater.
Mehr filmische Grenzgänge mit Edward Norton auf FILMTIPPS.at
9/10

3/10

9/10

10/10

7/10

9/10

7/10